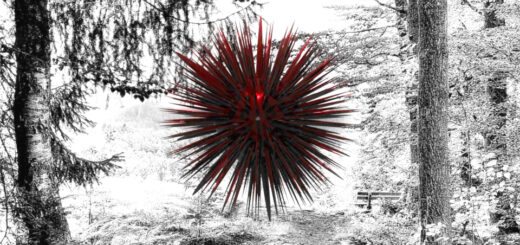Überleben alle? Nein. Die schöne Paula ist tot – Erster Teil.

Überleben wollen sie alle. Aber nur wenigen Auserwählten ist genau dieses vergönnt. Die Verworfenen werden nicht überleben. Den Besitz mehren, so lautet die magische Formel ihrer Religion. Besitz und Eigentum sind ihnen der einzig verbliebene Weg zur Befriedigung ihres Überlebenstriebs. Mehr als dieser Trieb ist ja nicht mehr übrig. Solidarität, Liebe und Leidenschaft? Wofür schlägt ihr Herz? Ihr Wille zum Guten ist längst als fauliger Kadaver herab gesunken, der eingequetscht zwischen Gier und Besitz zum Himmel stinkt. Was sind Besitz und Eigentum denn mehr als soziale Masturbation?
Aber jetzt ist die Zeit gekommen, da die gefälschte Freiheit den Besitzenden zum Gefängnis wird. Unentrinnbar schließen sich die Türen. Undurchdringlich erheben sich die Mauern. Wie wollen die Verworfenen überleben in Mitten tückischer Henker? Der Bausparvertrag zückt das Messer, die Lebensversicherung mischt das Gift, der Hauskredit gräbt die böse Falle, das Immobilien-Invest knüpft den Strang, das Gold-Depot befehligt das Erschießungskommando und das Aktienpaket schärft die Guillotine.
Was sie eben noch so wortreich wie verlogen demokratische Werte nannten, zerfließt sogleich in ihren Händen. Die angehäuften Reichtümer werden ihnen zum selbst gewählten Verhängnis. Blind für jede Menschlichkeit sehen ihre stumpfen Augen die eigenen Verbrechen nicht. Daher nehmen sie weder Schuld noch Strafe an.
Also bleibt diesen Elenden zum Überleben nur die Flucht in die Arbeit. Dort knien sie nieder, entbieten ihre Zunge dem zähen Schleim, der aus der Leiche der Geldwirtschaft auf sie nieder träufelt. Dieser Nektar gaukelt das Überleben vor. In Wahrheit jedoch ist er des Betruges giftige Essenz. Am Ende werden die Elenden selbst von dort vertrieben. In Treu und Glauben meinen sie ihre Schuldigkeit zu tun. Doch weit gefehlt. Ihre satten Herren entlassen sie ins Nichts.
Die warme Mahlzeit, das trockene Bett, der Arzt für die eiternden Wunden, vielleicht ein Stück Seife gegen den käsigen Gestank ihrer Lenden. Überleben in der puren Form. Wie waidwunde Wildschweine suchen die Fliehenden vom Schmerz getrieben einen letzten Schutz. Aber sie finden keinen Unterschlupf. Selbst die Dümmsten unter den Verworfenen schauen jetzt in den Spiegel und blicken voller Scham auf diesen Ekel. Es ist zu spät. Die Zeit ist abgelaufen. Das große Tor ist geschlossen.
Springe zu einem Abschnitt:
Kein Überleben für Paula: Hilferuf per SMS
Überleben. Nein. Die schöne Paula ist tot. Schön tot ist die Paula. Die Paula ist tot schön. Die Botschaft erreicht mich per SMS. Früh morgens, exakt um 10.05 Uhr. Das obszöne Piepen meins Handys weckt mich aus den süßen Träumen. Absender der Todesnachricht ist Dr.Thomas Busenberger. Unser lieber Hunde-Tommy will, dass ich sofort zu ihm auf den Berg Horeb komme.
Soll ich wirklich gehen? Mich auf den Weg quer durch Pirmasens machen? Ich lege das Handy beiseite, schiebe es neben meine Matratze auf die Dielen meiner Hütte. Dann strecke ich mich nochmal aus und sehe hoch zu den Balken unter dem Dach. Die aufkommende Hitze des Sommertages dehnt das Holz. Ich höre das Knacken im Gebälk, schließe die Augen und denke an die Nacht zurück.
Die lauwarme Kühle der Dämmerung befreite mein Gemüt von der flirrenden Last der rasenden Tageshitze. Also suchte ich den Platz unter den reifen Früchten des Birnbaums hinter meiner Hütte, breitete meine Decke im hohen Gras aus und schaffte zwei Kisten des wohlschmeckenden Gottbiers heran. Dann ließ ich mich nieder, begann den Reichtum der Nacht zu genießen in wundervoller Trunkenheit. Mal schaute ich zu den Sternen, mal hinüber auf die Lichter der Stadt, die mir so entlegen, so entfernt erschienen wie der Abendstern am Firmament.
Unter der Hecke stritten sich zwei schreiende Marder, beim dem Zwetschgenbaum machten sich die Bilche genüsslich über gefallene Pflaumen her. An meinen Füßen huschte eine Maus vorüber. In der keinen Höhle der Trockenmauer piepten ab und an die eben geschlüpften Rotschwänzchen. So saß ich da, lehnte am freundlichen Stamm des Birnbaums und erfreute mich des Friedens, bis das Gottbier zu Ende ging und über den beiden finsteren Türmen von St.Pirmin der Morgen dämmerte. Noch bevor die Sonne den Horizont berührte, begab ich mich in die Hütte, wo ich auf der Matratze in den wohligen Schlummer fiel.
Gefahr: Das Elend wütet hinterm Lenkrad
Und nun soll ich mich hinaus in die Welt der Verworfenen begeben? Eine Angst befällt mich beim Gedanken an die Straßen und Plätze. Da sind die geknechteten Männer und Frauen mit ihren Autos unterwegs. Hinter ihren Lenkrädern erheben sie sich vom Blut berauscht zu Herrinnen über Leben und Tod.
Aber wo müssen ihre bösen Fahrten enden? Am Arbeitsplatz, am Supermarkt, am Parkplatz vor dem Haus. Gelegentlich werden ihnen gerade noch gnädig ein Ausflug und die Fahrt zum Urlaub genehmigt. Fest erstarrt im irren Glauben, sie dürften mit dem Auto fahren wohin sie wollen, besudeln sie die Welt mit ihrem Lärm und ihrem Gift. In Wahrheit aber ist das Auto ist eine unsichtbare Sklavenkette. Aber weil sich die Verworfenen nicht weiter bewegen als erlaubt, spüren sie die Fessel nicht. Statt dessen zahlen die Elenden ihre Gefangenschaft in monatlichen Raten ab.
Dabei eifern diese Sklavinnen ihren längst entmenschten Besitzern nach. So wie ihre Vorbilder wollen sie den baren Nutzen hier und jetzt aus dem Leid der Anderen gewinnen. Beute machen, ausbeuten. Das ist ihr Begehren, ihr wahres Ziel. Diesen rasenden Bestien soll ich mich nun ausliefern, bloß weil die schöne Paula tot ist? Schon beim Gedanken an diesen blechernen Totentanz wird mir Angst und Bang. Ich zweifle, ob ich schnell und wendig genug sein werde, um den wütenden Elend zu entwischen.
In der hölzernen Decke über mir knackt es wieder, die Stunde wird heiß und heißer. Jetzt wäre die richtige Zeit gekommen, mich in den kühlen Schatten der großen Hecke zu verziehen. Wo der schöne Schlaf auch an heißen Tagen ungestört seine gute Träume behält, wäre jetzt mein Platz. Aber heute ist alles anders. Hunde-Tommys Nachricht beunruhigt mich. An den friedlichen Schlummer vermag ich kaum noch zu denken.
Solidarität ist moralische Pflicht
Ich erhebe mühsam meinen Oberkörper, sitze aufrecht über der Matratze. Dann greife ich wieder zum Handy. Jetzt kommt mir die Nachricht des Augenarztes doch verzweifelt vor. Er fragt nach meiner Hilfe, das sind nicht die Worte, aber ihre Botschaft. Hunde-Tommy ist ein Auserwählter wie ich. Ja, ich kann und darf ihm seinen Wunsch nicht abschlagen. Ihm die Solidarität zu verweigern, wäre unmoralisch und verstieße gegen die Regeln der Pirmasenser Kolonie.
Die schmal linierte, aber breit karierte blaue Dreiviertelhose und das braune T-Shirt habe ich noch an. Was mir fehlt, sind die Sandalen. Da ich das Schuhwerk in der Hütte nicht finde, muss ich die Latschen in der Nacht bestimmt am Birnbaum vergessen haben. Ich verlasse die Hütte und gehe die wenigen Schritte barfuß den Pfad entlang. Tatsächlich, dort entdecke ich sie gleich. Die Sandalen liegen neben der Decke im Gras. Als ich hineinschlüpfe und den Klettverschluss über der Verse fest mache, fällt mein Blick auf die leeren Gottbierflaschen. Doch in der zweiten Kiste sind noch sechs halbe Liter übrig.
Ein gestärkter Aufbruch
Das heilige Getränk darf keinesfalls unter der heißen Sonne stehen bleiben. Wenn doch, dann könnte die eine oder andere Flasche platzen. Wenigstens würde das kostbare Bier warm, so dass es kaum noch zu genießen wäre. Von der verlorenen Erfrischung mag ich gar nicht reden. Um mich vor den drohenden Verlusten zu bewahren, trage ich das restliche Gottbier zum Brunnen neben der Geistlichen Hütte und versenke die Kiste im Becken mit kühlem Wasser. Da schon wieder der Durst in meiner Kehle brennt, öffne ich sogleich eine Flasche an Ort und Stelle. Ein weiser Entschluss. Obwohl bereits lauwarm, erfrischt mich das Gottbier doch.
Die Erfrischung mag der Segen Gottes bewirken, den unser Pfarrer Theophil Meisterberg den Flaschen bei der Lieferung erteilte. So hat der Gottesmann das alkoholische Gebräu auf mystische Weise zum Gottbier verwandelt. Jedenfalls fühle ich mich nach dem Trunk ausreichend gestärkt für den langen und gefährlichen Weg von der Kolonie bis zu Paulas Haus auf dem Berg Horeb. Das Gottbier gibt mir Kraft und Entschlossenheit zum Überleben. Also ziehe ich los, verlasse die Pirmasenser Kolonie schreite mutig voran.
Claude Otisse